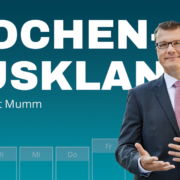Der stagflationär wirkende Schock der Ukrainekrise sowie die globalen Lieferkettenprobleme durch die Corona-Restriktionen in China sorgen weiterhin für sinkende Wachstums- und gleichzeitig steigende Inflationsprognosen. So reduzierte das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) kürzlich die Erwartung für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr auf nur noch 1,7 Prozent, gefolgt von 2,5 Prozent im Jahr 2023.
BEITRAGS ARCHIV
ALLER BISHERIGEN BEITRÄGE
„DONNER & REUSCHEL Markt kompakt“ ist der neue bi-weekly Talk mit Carsten Mumm, unterstützt von GFD Finanzkommunikation. In nur wenigen Minuten erhalten Sie einen Überblick zu den Marktthemen der Woche und einen Einblick in die Hot Topics – schnell, kompakt und auf den Punkt.
Manch einer liebt den Nervenkitzel. Andere hingegen brauchen das Gefühl von Sicherheit. Wie wir unsere Karriere, die Finanzen, den Urlaub, ja, das ganze Leben planen, hängt stark davon ab, wie risikofreudig wir sind. Dabei muss das Sicherheitsbedürfnis nicht besser oder schlechter sein als der Hang zum Risiko. Im Gegenteil: Oft helfen mutige Entscheidungen bei dem Streben nach Sicherheit.
Die Belastungen durch Corona-Restriktionen nehmen weltweit überwiegend ab und ermöglichen eine Erholung der besonders betroffenen Bereiche, wie bspw. Handel oder Freizeiteinrichtungen. Nur in China wurden zuletzt Lockdowns deutlich ausgeweitet, da die Fallzahlen nach wie vor steigen. Dadurch wird der Konsum eingeschränkt, Fabriken und Produktionsanlagen schließen und auch Lieferketten werden erneut belastet.
Haben Sie schon mal über Geschmack gestritten? Was ist eigentlich ein guter Geschmack? Diesen Fragen gehen Stella Pfeifer und Jonas Ross in der dritten Folge von „Wahre Werte – Der Podcast über Investitionen in ein gutes Leben“ nach. Muss man sich guten Geschmack leisten können?
im Falle einer Eskalation des Ukraine-Konfliktes stünde wirtschaftlich einiges auf dem Spiel, kurzfristig vor allem für Europa, aber auch für Russland selbst. Der Ausfall russischer Öl- und Gasexporte würde eine erneute Preisexplosion am Energiemarkt bedeuten.
„Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele desjenigen, der sie betrachtet“, sagte der britische Schriftsteller David Hume (1711-1765). Wie kommt es, dass wir uns scheinbar wertlose Gegenstände Unsummen kosten lassen? Welche Motivation steckt hinter dem Sammeln? Und wie lassen sich Sammelleidenschaft und Geldanlage mit einander verbinden?
Trotz der weltweit massiv steigenden Corona-Neufallzahlen halten sich die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen. So zeigen Mobilitätsdaten für Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel in verschiedenen Staaten Europas zwar einen nachlassenden Kundenverkehr an, allerdings fällt das Ausmaß deutlich geringer aus als im Zuge der restriktiveren Corona-Restriktionen im Vorjahreszeitraum.